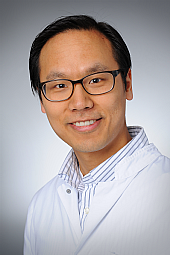- Startseite
- Forschung
- Klinische Kardiologie und Intensivmedizin
- Cluster für Biologie des Leukozyten
- Cluster Wachstumsfaktoren des pulmonal-vaskulären Remodellings
- Immunzellantwort in kardiovaskulären Erkrankungen
- Inflammation im Rahmen der Herzinsuffizienz
- Strukturelle Herzerkrankung
- Klinische Kardiologie und Intensivmedizin
- Arbeitsgruppe Herzinsuffizienz
- Kardiale Zellersatz- & translationale Herzinsuffizienztherapie
- Elektrophysiologie
- Kontraktionskopplung und Calcium-Signaling
- Kardiovaskuläre Epidemiologie des Alterns
Arbeitsgruppe Klinische Kardiologie und Intensivmedizin
Die Arbeitsgruppe „Klinische Kardiologie und Intensivmedizin“ der Klinik III für Innere Medizin betreut klinische und wissenschaftliche Fragestellungen aus der prä- und innerklinischen Akutmedizin mit kardiologischem Schwerpunkt.
Die thematischen Schwerpunkte sind an der Herausforderung dieses Fachbereiches orientiert: Schnittstellenmanagement ist ein zentraler Ankerpunkt in der kardiologischen Intensivmedizin. Wir widmen uns beispielhaft der wichtigen Schnittstelle aus prä-, früh innerklinischer und intensivmedizinischer Differenzialdiagnose sowie Behandlung des akuten Brustschmerzes. Unser ausgewähltes Team repräsentiert dabei diese Bereiche, um auch hier dieses Schnittstellenmanagement abzubilden.
Eine hierbei wichtige Patientengruppe stellen diejenigen mit transmuralem Herzinfarkt (ST-Streckenhebungsinfarkt, STEMI) dar. Diese betreuen wir mit dem Ziel einer konsequenten Steigerung der Prozess-, Ergebnis- und Versorgungsqualität im Rahmen des interprofessionellen und multizentrischen Kölner Infarkt Modells (KIM).
Ein weiterer Eckpfeiler unserer wissenschaftlichen Ausrichtung ist das Verständnis um die Mechanismen, die hämodynamischen Auswirkungen und die Prädikatoren für den kardiogenen Schock. Es handelt sich um eine heterogene Patientengruppe mit ungebrochen hoher Sterblichkeit, sodass die Bemühungen an einer optimierten Versorgung orientiert sind. Insbesondere für diejenigen Patientinnen und Patienten, die unter einem kardiogenen Schock einen Herzkreislaufstillstand erleiden sind konsequente Weiterentwicklungen der therapeutischen Optionen notwendig, um der Sterblichkeitsrate (>50%) und den Sekundärschäden der Überlebenden durch Behinderung sowie Invalidität zu begegnen. Hierauf zielen unsere wissenschaftlichen Bemühungen ebenfalls ab.
Entwicklung und Implementierung neuer therapeutischer Strategien zur Behandlung des außerklinischen Herzkreislaufstillstandes
Mehr als 70.000 Menschen erleiden in Deutschland jedes Jahr einen Herz-Kreislauf-Stillstand außerhalb eines Krankenhauses („out-of hospital cardiac arrest“, OHCA). In der Mehrzahl der Fälle ist der OHCA auf eine kardiale Genese (Myokardinfarkt, Rhythmusereignis) zurückzuführen. Trotz intensiver Bemühungen verbleibt das Outcome, insbesondere im Hinblick auf das Wiedererlangen einer akzeptablen Lebensqualität, in diesem Patientenkollektiv auf unverändert niedrigem Niveau. In der Stadt Köln überleben derzeit nur 8 – 10% ein solches Ereignis. Die Mehrzahl der betroffenen Patienten mit OHCA erreicht nicht das Krankenhaus, sondern verstirbt noch an der Einsatzstelle. Die diagnostischen und therapeutischen Optionen sind im außerklinischen Bereich, im Vergleich zu einer Versorgung in einem Krankenhaus, limitiert.
Vor diesem Hintergrund untersuchen wir daher präklinische- und klinische Einflussfaktoren auf Morbidität und Mortalität bei Patienten mit OHCA. Ziel der Arbeitsgruppe ist es, neue therapeutische- und logistische Strategien zu identifizieren und deren Umsetzung in Hinsicht auf das Outcome der Patienten zu überprüfen.
Der akute Thoraxschmerz ist ein häufiger Vorstellungsgrund in der Notaufnahme. Die Genese ist mannigfaltig und das Spektrum potentiell lebensbedrohlicher Differenzialdiagnosen ist groß. Viele Patienten mit akutem Thoraxschmerz werden durch den Rettungsdienst vorgestellt. Im Gegensatz zu einem stationären Setting in einer Notaufnahme sind die diagnostischen Möglichkeiten im prähospitalen limitiert. Vor diesem Hintergrund ist eine exakte Diagnosestellung häufig erst im Krankenhaus möglich.
Ziel der Arbeitsgruppe ist es, anhand dieses Kollektivs Risikofaktoren zu identifizieren, die die prähospitale Diagnosefindung erleichtern. Unter epidemiologischen Gesichtspunkten werden zudem Implementierungs- und Umsetzungsstrategien von Leitlinien sowie medizinische Effekte einer strukturierten Versorgung überprüft.
Der kardiogene Schock stellt die häufigste letale Komplikation nach einem akuten Myokardinfarkt dar. Pathophysiologisch liegt einem kardiogenen Schocks eine durch die Myokardischämie verursachte kritische Abnahme des Herzzeitvolumens zugrunde. Der verminderte koronare Perfusionsdruck sowie der erhöhte Sauerstoffbedarf des Myokards triggern akute Kompensationsmechanismen wie die Aktivierung des sympathischen Nervensystems und des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems. Neben den hämodynamischen Auswirkungen spielen auch neurohormonale und inflammatorische Faktoren bei der Unterhaltung des kardiogenen Schock eine entscheidende Rolle. Infolge der Minderperfusion und anhaltender Hypoxie entwickeln sich progrediente Mikrozirkulationsstörungen, welche mit Auftreten eines Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS) assoziiert sind.
Trotz moderner intensivmedizinischer Strategien und fortschrittlicher Postinfarkttherapie liegt die Mortalität bei Patienten mit kardiogenem Schock konstant hoch (~ 50%). Unsere Arbeitsgruppe untersucht daher schockassoziierte Einflüsse auf den systemischen Kreislauf, die myokardiale Funktion sowie auf Inflammation bei Patienten mit kardiogenem Schock. Ziel ist es, Mechanismen zu identifizieren die Einfluss auf die Sterblichkeit haben können.
Das Kölner Infarkt Modell (KIM) ist eine 2005 gegründete Kooperation der 16 Kölner Akutkrankenhäuser und des Rettungsdienstes der Stadt Köln mit der Zielsetzung die Behandlung und Therapie von Menschen mit einem ST-Streckenhebungsinfarkt (STEMI) zu optimieren. Der Zusammenschluss umfasst sechs Krankenhäuser mit einer Herzkatheterbereitschaft über 24 Stunden an jedem Wochentag. Die weiteren Krankenhäuser übernehmen die zentrale Rolle in der Akutstabilisierung der kritisch kranken Patienten und organisieren den umgehenden Transfer in das nächstgelegene Herzkatheterlabor. Aus den Registerdaten können zentrale Schlüsse zur Versorgungsforschung abgeleitet und Prognosefaktoren identifiziert werden. Das Register erlaubt zudem die Analyse von Einflussfaktoren auf Diagnostik sowie Therapie dieser Patienten und trägt zu einer konsequenten Steigerung der Prozess-, Ergebnis- und Versorgungsqualität bei.
Optical coherence tomography-guided versus angiography-guided percutaneous coronary intervention in acute coronary syndrome: a meta-analysis. Macherey-Meyer S, Heyne S, Meertens MM, Braumann S, Tichelbäcker T, Wienemann H, Mauri V, Baldus S, Lee S, Adler C. Clin Res Cardiol. 2023 [Epub ahead of print].
Outcome of Out-of-Hospital Cardiac Arrest Patients Stratified by Pre-Clinical Loading with Aspirin and Heparin: A Retrospective Cohort Analysis. Macherey-Meyer S, Heyne S, Meertens MM, Braumann S, Niessen SF, Baldus S, Lee S, Adler C. Journal of Clinical Medicine. 2023
Acute Chest Pain—Diagnostic Accuracy and Pre-hospital Use of Anticoagulants and Platelet Aggregation Inhibitors. Braumann S, Faber-Zameitat C, Macherey-Meyer S, Tichelbäcker T, Meertens M, Heyne S, Nießen F, Nies RJ, Nettersheim F, Reuter H, Pfister R, Hellmich M, Burst V, Baldus S, Lee S, Adler C. Dtsch Arztebl Int. 2023
Coronary angiography after cardiac arrest without ST-elevation myocardial infarction: a network meta-analysis. Heyne S, Macherey S, Meertens MM, Braumann S, Nießen FS, Tichelbäcker T, Baldus S, Adler C, Lee S. Eur Heart J. 2023
Meta-analysis of extracorporeal membrane oxygenation in combination with intra-aortic balloon pump vs. extracorporeal membrane oxygenation only in patients with cardiogenic shock due to acute myocardial infarction. Meertens MM, Tichelbäcker T, Macherey-Meyer S, Heyne S, Braumann S, Nießen SF, Baldus S, Adler C,Lee S. Front Cardiovasc Med. 2023
In- our out-of-hospital ECMO implantation? Impact of infrastructure, logistic conditions and legal circumstances. Macherey-Meyer S. and Adler C. ECMO Retrieval Program Foundation. Sabashnikov A, Wahlers T (Ed.). Springer Cham Switzerland, December 2022.
Out-of-hospital cardiac arrest. Achilles’ heel in cardiovascular medicine. Adler C, Heyne S, Meertens MM, Macherey-Meyer S, Baldus S. ECMO Retrieval Program Foundation. Sabashnikov A, Wahlers T (Ed.). Springer Cham Switzerland, December 2022.
Impact of respiratory infectious epidemics on STEMI incidence and care. Macherey S, Meertens MM, Adler C, Braumann S, Heyne S, Tichelbäcker T, Nießen FS, Christ H, Ahrens I, Baer FM, Eberhardt F, Horlitz M, Meissner A, Sinning JM, Baldus S, Lee S. Scientific reports. 2021.
Absolute serum neurofilament light chain levels and its early kinetics predict brain injury after out-of-hospital cardiac arrest. Adler C, Onur OA, Braumann S, Gramespacher H, Bittner S, Falk S, Fink GR, Baldus S, Warnke C. J Neurol 2021.
How long is long enough? Good neurologic outcome in out-of-hospital cardiac arrest survivors despite prolonged resuscitation: a retrospective cohort study. Braumann S, Nettersheim FS, Hohmann C, Tichelbäcker T, Hellmich M, Sabashnikov A, Djordjevic I, Adler J, Nies RJ, Mehrkens D, Lee S, Stangl R, Reuter H, Baldus S, Adler C. Clin Res Cardiol 2020.
One year experience with fast track algorithm in patients with refractory out-of-hospital cardiac arrest. Adler C, Paul C, Michels G, Pfister R, Sabashnikov A, Hinkelbein J, Braumann S, Djordjevic I, Blomeyer R, Krings A, Böttiger BW, Baldus S, Stangl R. Resuscitation 2019.
TIMP-2/IGFBP7 predicts acute kidney injury in out-of-hospital cardiac arrest survivors. Adler C, Heller T, Schregel F, Hagmann, H, Hellmich M, Adler J, Reuter H. Crit Care 2018.
2. Preis Young Investigator Award - Koronare Herzerkrankungen - Koronare Herzerkrankung der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie 2022:
Heyne S, Macherey S, Meertens MM, Braumann S, Nießen FS, Tichelbäcker T, Baldus S, Adler C, Lee S.Coronary angiography after cardiac arrest without ST-elevation myocardial infarction. A Systematic Review and Meta-analysis
2. Preis des Young Investigator Award – Koronare Herzerkrankung der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie 2021:
S. Macherey-Meyer, M. M. Meertens, H. Christ, C. Adler, I. Ahrens, F. M. Baer, F. Eberhardt, M. Horlitz, J.-M. Sinning, A. Meissner, S. Baldus, S. Lee, für die Studiengruppe: KIM eV (Köln). Treatment delay of patients with ST-elevation myocardial infarction during the COVID-19 pandemic in a metropolitan area of Germany.